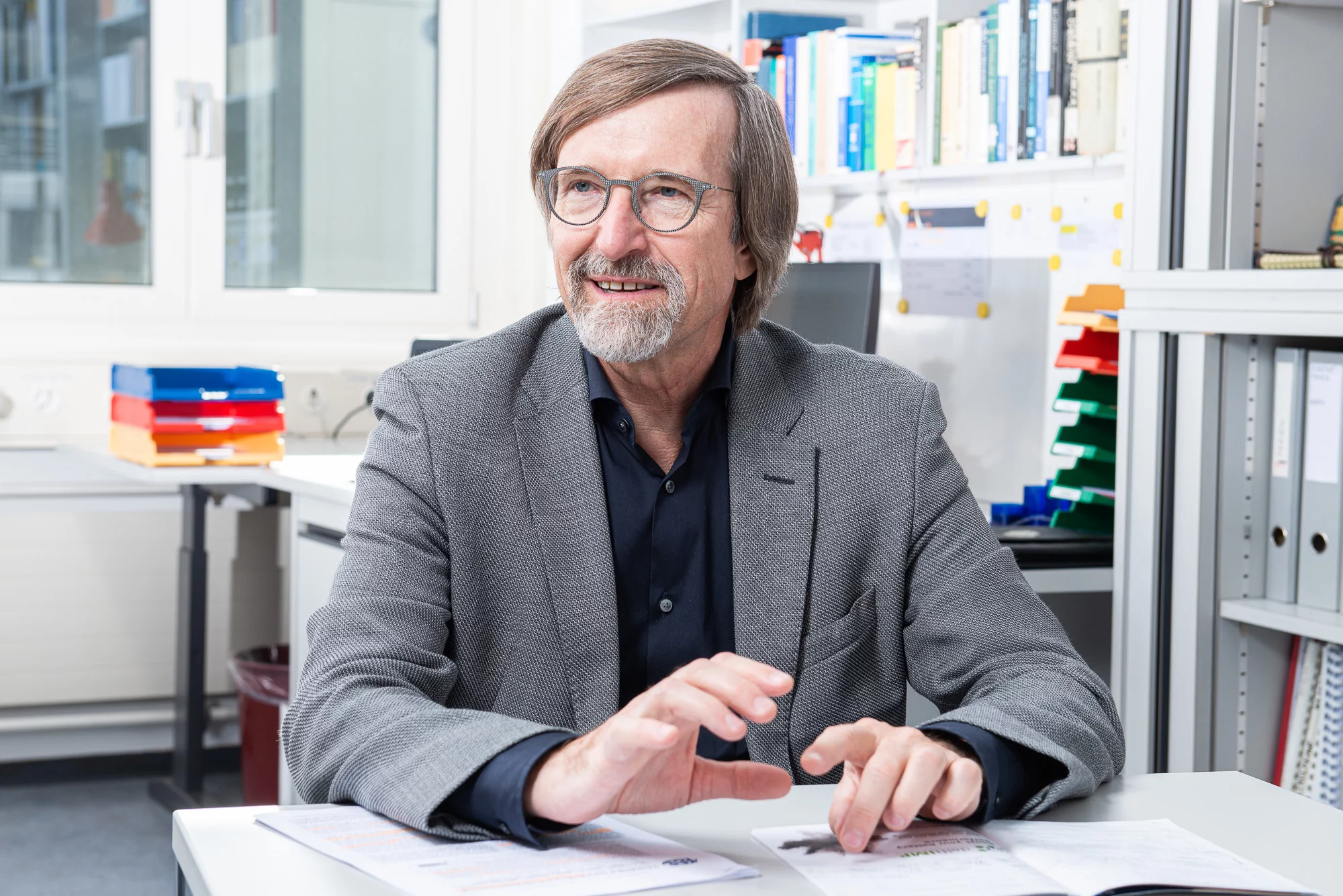Drei Forscher teilen sich dieses Jahr den Nobelpreis in Chemie. Sie werden für ihren jeweiligen Beitrag in der Forschung ausgezeichnet, die zu den heutigen wieder aufladbaren Lithium-Ionen-Batterien geführt hat. Und uns damit Smartphones und Elektroautos in der heutigen Form ermöglicht. Petr Novák forscht am PSI an Lithium-Ionen-Batterien und kennt die drei Preisträger seit Jahrzehnten persönlich. Im Interview erzählt er, wie er einem von ihnen im entscheidenden Moment gegenübersass.
Herr Novák, Sie waren in den vergangenen Tagen im süddeutschen Ulm, wo genau zur Zeit der Vergabe der naturwissenschaftlichen Nobelpreise eine Konferenz zu Batterieforschung stattfand. War diese Konferenz Zufall?
Das war absolut Zufall. Und es war auch Zufall, dass man den künftigen Nobelpreisträger Stanley Whittingham dort treffen konnte. Am Mittwoch, also am Tag des Chemie-Nobelpreises, hielt er im Zuge der Vormittagssitzung um 8:30 Uhr seinen Vortrag. Also kurz bevor dann um 11:50 Uhr der Nobelpreis verkündet wurde.
Auch Whittingham selbst hatte es kaum früher erfahren; das ist das ganz übliche Vorgehen vom Nobelkomitee. Ich habe nur bemerkt, dass er zwei Mal zum Telefonieren aus dem Raum gegangen ist. Danach musste er noch eine halbe Stunde lang alles für sich behalten.
Und dann?
Um 11:50 Uhr sass ich auf der Bühne und hatte den Vorsitz über die weitere Vormittagssitzung. Ich habe aufs Handy geschaut, wer den Chemie-Nobelpreis bekommt. Und im ersten Moment konnte ich es kaum glauben. Auch wenn für mich das Thema Lithium-Ionen-Batterien einer der Favoriten für den Preis war und damit auch ganz klar Whittingham, war es doch surreal, dass ich den Nobelpreisträger vor mir im Publikum sitzen hatte.
Ich habe dann auf der Bühne die Vortragsreihe kurz unterbrochen und den Nobelpreis verkündet. Das war mir eine grosse Freude.
Für Sie war also klar: Wenn Lithium-Ionen-Akkus das Thema werden, dann ist Whittingham einer der Preisträger. Trifft das auch auf die anderen beiden zu, also John Goodenough und Akira Yoshino?
Ja. Auch wenn es im Laufe der Jahrzehnte viel Forschung von sehr vielen Menschen gab: Die drei sind eine sehr gute Auswahl der Leute, die an dieser Entwicklung beteiligt waren.
Was ist Ihre Erinnerung an diese Jahrzehnte der Batterieforschung?
Was jetzt ausgezeichnet wurde, war eine Entwicklung, die im Jahr 1976 begann. Damals hat Stanley Whittingham eine wieder aufladbare Batterie mit Lithium gebaut, von dem man theoretisch schon wusste, dass es manch geeignete Eigenschaft hat. Eine Batterie besteht im Wesentlichen aus den beiden Elektroden – der Kathode und der Anode – und aus dem Elektrolyten. Der meist flüssige Elektrolyt hilft, dass die Lithiumionen zwischen Kathode und Anode hin- und herwandern können. Beim Aufladen hin, beim Entladen her. Whittingham hat als erster ein Material ausfindig gemacht, mit dem sich eine gut funktionierende Kathode umsetzen liess: Titandisulfid.
Whittingham baute also den ersten Lithium-Ionen-Akku?
Das kann man sagen. Aber die heutigen Lithium-Ionen-Batterien setzen sich aus anderen Materialien zusammen. Denn weiter ging es schon drei Jahre später, als John Goodenough 1979 zeigte, dass Kobaltdioxid noch besser geeignet ist als Material für die Kathode.
Doch auf der Seite der Anode blieb noch ein Problem. Die baute man damals aus reinem Lithium oder aus Lithium-Aluminium-Legierungen. Das war naheliegend, aber nicht ideal. Akira Yoshino hat darum verschiedene Materialien durchprobiert, die als Träger für Lithiumionen dienen könnten. Er wurde bei Petrolkoks fündig, das als Abfallprodukt der Erdölverarbeitung preislich sehr günstig ist und sich nach spezieller Behandlung für die Anode eignet. Der erste Lithium-Ionen-Akku nach diesem Design kam 1991 auf den Markt.
Wieso hat es nach Whittingham und Goodenough noch bis 1991 gebraucht?
Die Forschung und Entwicklung zog einfach Ende der 80er-, Anfang der 90er-Jahre an: Da kam die Miniaturisierung von Elektronikgeräten. Ich erinnere mich, dass Sony eine kleine, leistungsfähige Batterie brauchte, um die damalige Welle tragbarer Geräte – Walkman, Discman, Videokameras – weiterzuentwickeln. Aus meiner Sicht verdanken wir unter anderem dem Discman die Lithium-Ionen-Akkus!
Und wie ist die Forschung und Entwicklung von Lithium-Ionen-Batterien seit 1991 weitergegangen?
Seit 1991 gab es keine bahnbrechenden Änderungen mehr, aber stetige Verbesserungen. An der genauen Zusammensetzung der Materialien für Kathode und Anode wurde und wird weiterhin geforscht. In der Kathode versucht man aus Gründen der Kosten und der Ethik den Anteil an Kobalt möglichst gering zu halten. Man wählt andere Zusammensetzungen, die eine noch etwas höhere Energiedichte haben. Und die Anoden sind heute nicht mehr aus Koks, sondern standardmässig aus Graphit. Einige werden auch schon aus einer Mischung aus Graphit und Silizium hergestellt.
Auch die Batterieforschung am PSI ist zu 90 oder sogar mehr Prozent die Forschung an Lithium-Ionen-Batterien. Wir haben unter anderem schon über zwei Jahrzehnte eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Unternehmen «Imerys Graphite & Carbon» im Tessin, die einen wesentlichen Anteil am Markt für Graphite haben. Mit Imerys forschen wir an Graphit-Elektroden für Lithium-Ionen-Batterien.
Steckt heute im Smartphone genau der gleiche Akku wie im Elektroauto?
Eben nicht ganz. Heute gibt es verschiedene Typen von Lithium-Ionen-Batterien, die je nach Anwendung optimiert sind: Bei Handyakkus priorisiert man die Energiedichte – und nimmt dafür eine Lebensdauer von nur rund zwei Jahren in Kauf. Umgekehrt entwickelt man für die Elektromobilität Batterien mit hoher Zuverlässigkeit und Lebensdauer. Wieder anderswo will man vielleicht hohe Leistung. All dies lässt sich durch kleine Unterschiede im mechanischen Design und Materialwahl erreichen: Da geht es zum Beispiel um die Dicke der Elektrode, die Porosität der Materialien, auch kleine Unterschiede in der Zusammensetzung des Elektrolyten und der Elektrodenmaterialien können gezielt eine gewünschte Eigenschaft verbessern.
Wollen Sie jetzt auch wie Goodenough 97 Jahre alt werden und dann den Nobelpreis bekommen?
Ach, ich will am Ball bleiben. Und weiter Wissenschaft machen.
Interview: Paul Scherrer Institut/Laura Hennemann
Über das PSI
Das Paul Scherrer Institut PSI entwickelt, baut und betreibt grosse und komplexe Forschungsanlagen und stellt sie der nationalen und internationalen Forschungsgemeinde zur Verfügung. Eigene Forschungsschwerpunkte sind Materie und Material, Energie und Umwelt sowie Mensch und Gesundheit. Die Ausbildung von jungen Menschen ist ein zentrales Anliegen des PSI. Deshalb sind etwa ein Viertel unserer Mitarbeitenden Postdoktorierende, Doktorierende oder Lernende. Insgesamt beschäftigt das PSI 2100 Mitarbeitende, das damit das grösste Forschungsinstitut der Schweiz ist. Das Jahresbudget beträgt rund CHF 407 Mio. Das PSI ist Teil des ETH-Bereichs, dem auch die ETH Zürich und die ETH Lausanne angehören sowie die Forschungsinstitute Eawag, Empa und WSL. (Stand 05/2019)
Weiterführende Informationen
SWR-Bericht: Wie Stanley Whittingham auf einer Konferenz zu Batterieforschung in Ulm vom Nobelpreis erfuhr.
Kontakt/Ansprechpartner
Prof. Dr. Petr Novák
Paul Scherrer Institut, Forschungsstrasse 111, 5232 Villigen PSI, Schweiz
Telefon: +41 56 310 24 57, E-Mail: petr.novak@psi.ch