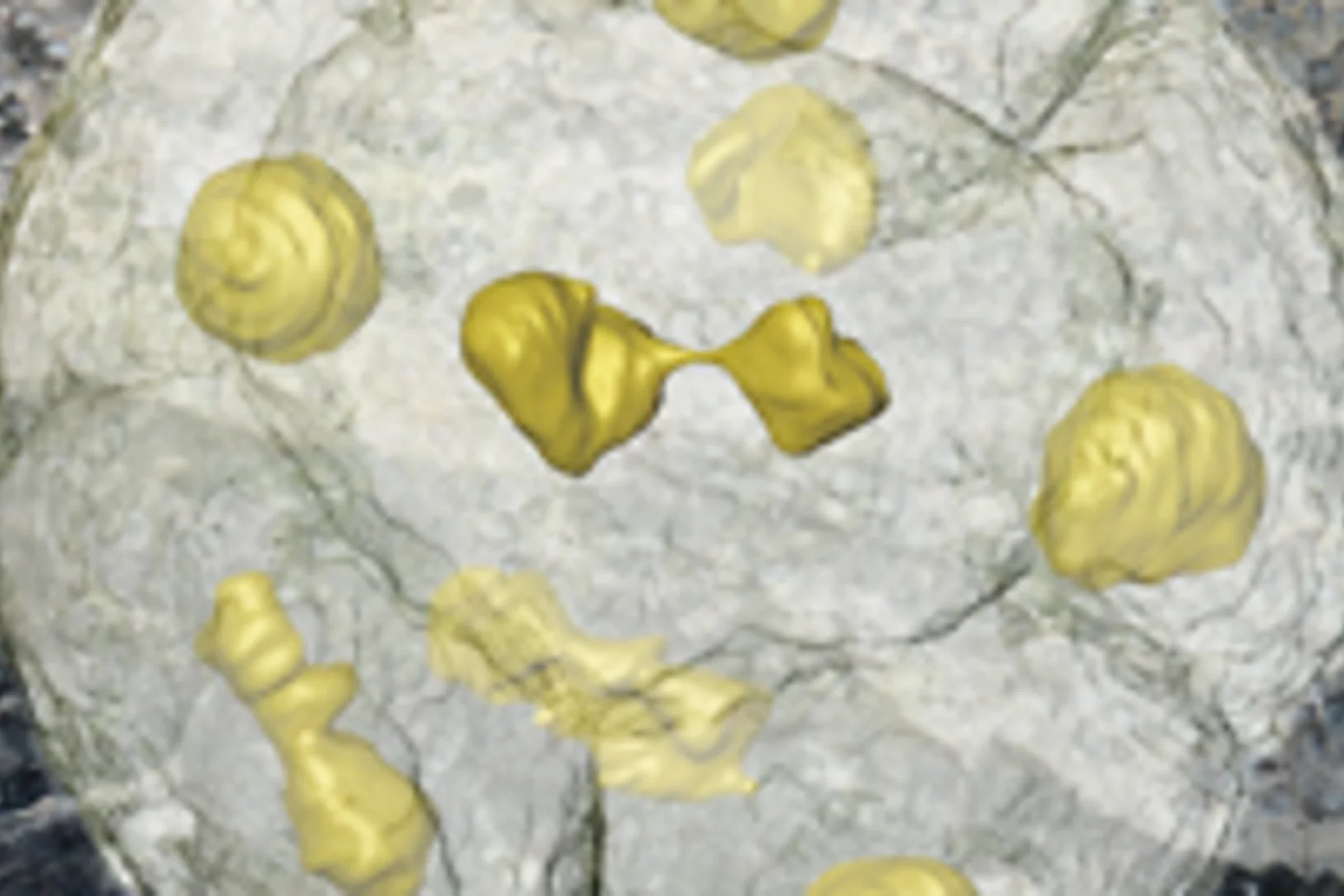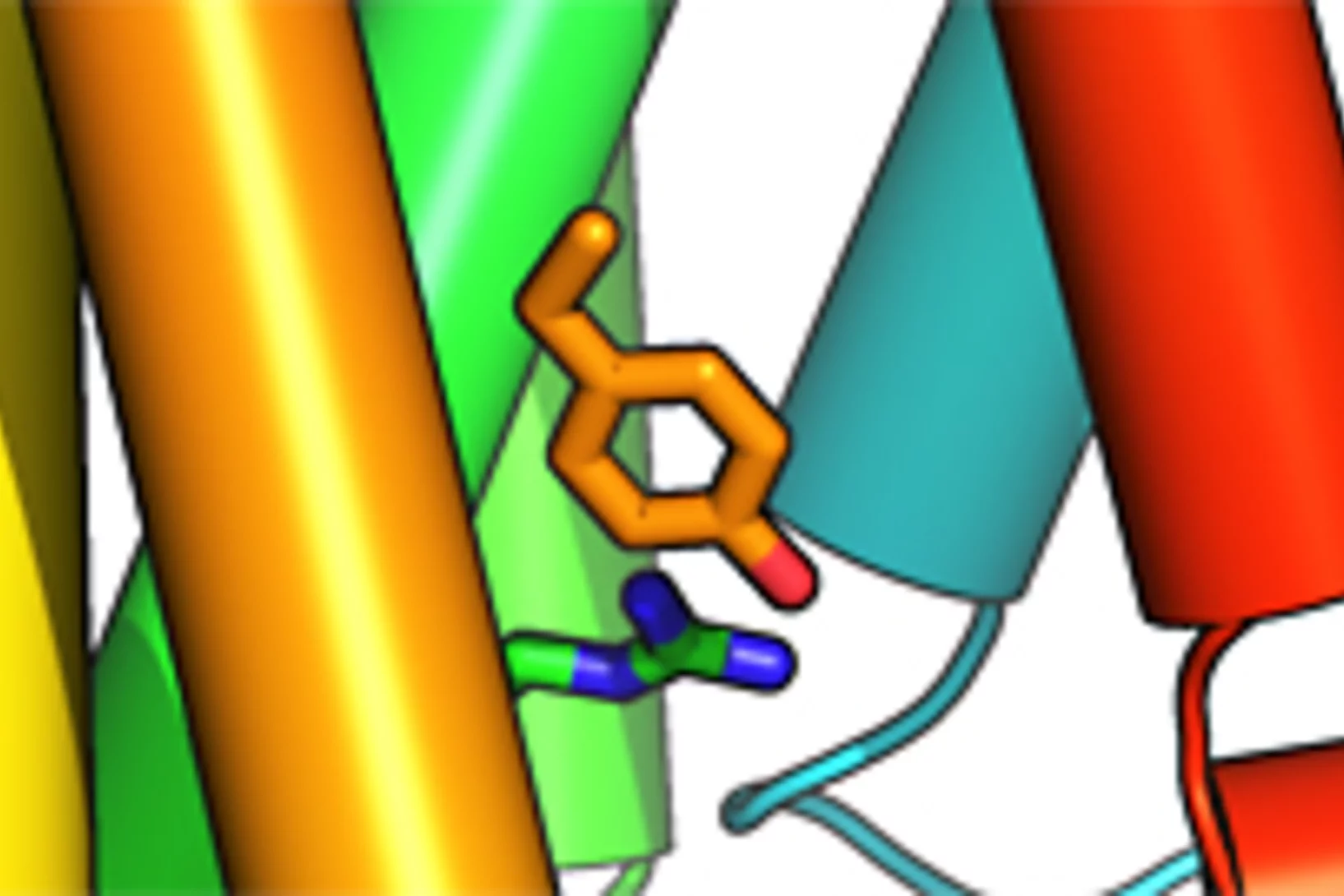SLS
Fossile Vorläufer der ersten Tiere
Einzellige Organismen, die vor über einer halben Milliarde Jahre gelebt haben und deren Fossilien in China gefunden wurden, sind wohl die unmittelbaren Vorläufer der frühesten Tiere. Die amöbenartigen Einzeller haben sich in einer Weise in zwei, vier, acht usw. Zellen geteilt, wie es heute tierische (und menschliche) Embryonen tun. Die Forscher glauben, dass diese Organismen einem der ersten Schritte vom Einzeller zum Vielzeller in der Entwicklung richtiger Tiere entsprechen.
Wenn die Datenleitung in die Zelle versagt
Lebende Zellen empfangen dauernd Informationen von aussen, die über Rezeptoren in das Zellinnere weitergeleitet werden. Genetisch bedingte Fehler in solchen Rezeptoren sind der Grund für zahlreiche Erbkrankheiten darunter verschiedene hormonelle Funktionsstörungen oder Nachtblindheit. Forschern des Paul Scherrer Instituts ist es nun erstmals gelungen, die exakte Struktur eines solchen fehlerhaften Rezeptors aufzuklären.
Nanoforscher untersuchen Karies
Forscher der Universität Basel und des Paul Scherrer Instituts konnten im Nanomassstab zeigen, wie sich Karies auf die menschlichen Zähne auswirkt. Ihre Studie eröffnet neue Perspektiven für die Behandlung von Zahnschäden, bei denen heute nur der Griff zum Bohrer bleibt. Die Forschungsergebnisse wurden in der Fachzeitschrift «Nanomedicine» veröffentlicht.
Zehn Jahre Forschung in der fliegenden Untertasse
Mit einem Festakt hat das Paul Scherrer Institut (PSI) in Villigen (AG) heute an das zehnjährige Bestehen ihrer bedeutendsten Grossforschungsanlage erinnert. Seit der Inbetriebnahme im Sommer 2001 haben Tausende von Forschern aus Hochschule und Industrie an der Synchroton Lichtquelle Schweiz (SLS) qualitativ hochwertige Experimente durchgeführt. Ihre Forschung mündete in über 2000 wissenschaftlichen Publikationen und brachte darüber hinaus einen Nobelpreis sowie eine Vielzahl industrieller Anwendungen hervor.
Unseren frühen Vorfahren in den Kopf (und in die Nase) geschaut
Der Umbau des Gehirns und der Sinnesorgane dürfte den Erfolg der Wirbeltiere, eines der grossen Rätsel der Evolutionsbiologie, erklären à so die Aussage einer Arbeit, die heute im Wissenschaftsjournal Nature erschienen ist. Die Forschenden konnten das Rätsel durch Untersuchungen des Gehirns eines 400 Millionen Jahre alten versteinerten Fisches à eines evolutionären Bindeglieds zwischen den heute lebenden kiefertragenden Wirbeltieren und den Kieferlosen.
Röntgen-Methode hilft Hirnerkrankungen besser zu verstehen
Ein internationales Forschungsteam hat eine neue Methode entwickelt, mit der man detaillierte Röntgenbilder von Hirngewebe erstellen kann. Die Methode wurde verwendet, um die Myelinscheide der Nervenfasern sichtbar zu machen. Schäden an der Myelinscheide führen zu verschiedenen Erkrankungen wie etwa Multiple Sklerose. Die Anlage, an der diese Aufnahmen erstellt werden können, wird an der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS des Schweizer Paul Scherrer Instituts betrieben.
Grundstrukturen des Sehens entschlüsselt
Am Anfang des Sehvorgangs steht die Wechselwirkung des Lichts mit dem Protein Rhodopsin. Dieses enthält den eigentlichen Lichtsensor, der angeregt wird, seine Form zu verändern und so den Rest des Vorgangs anzustossen. Forscher haben die Struktur des Rhodopsinmoleküls in dem kurzlebigen angeregten Zustand bestimmt und so ein genaues Bild der ersten Stufe des Sehvorgangs geliefert.
Dem Rätsel der Centriolen-Bildung auf der Spur
In menschlichen Zellen finden sich stammesgeschichtlich sehr alte Funktionseinheiten, die als Centriolen bezeichnet werden. Ein Forscherteam vom PSI und der ETH Lausanne hat nun erstmals ein Modell für die Bildung der Centriolen vorgestellt. Das erstaunende Ergebnis ist, dass die Neuner-Symmetrie des Centriols durch die Fähigkeit eines einzelnen Proteins sich selbst zu organisieren zustande kommt.
Die Nanomaschinen des Lebens verstehen
Ribosomen sind die Proteinfabriken der lebenden Zellen à und selbst auch hochkomplexe Biomoleküle. Eine französische Forschungsgruppe hat nun erstmals die Struktur von Ribosomen in eukaryotischen Zellen bestimmt, also in komplexen Zellen, die über einen Zellkern verfügen. Ein wesentlicher Teil der Experimente wurde an der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS des Paul Scherrer Instituts durchgeführt.
Magnetische Monopole auf Wanderschaft
Seit Jahrzehnten suchen Forschende nach magnetischen Monopolen à einzelnen magnetischen Ladungen, die sich wie einzelne elektrische Ladungen alleine bewegen könnten. Nun ist es einem Team von Forschenden des Paul Scherrer Instituts und des University College Dublin gelungen, Monopole als Quasiteilchen in einer Anordnung von nanometergrossen Magneten zu erzeugen und ihre Bewegung unmittelbar zu beobachten.