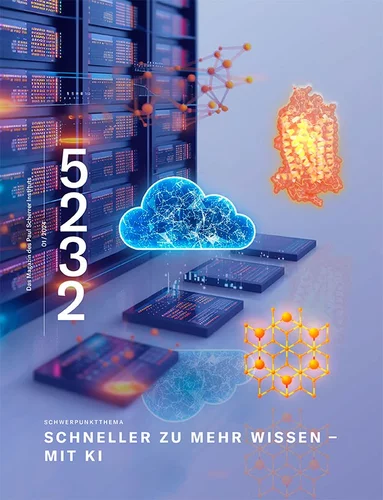Von ihrem Büro aus hat Lubna Dada einen guten Blick auf eine schöne Wiese, die jetzt, im April, kräftig zu spriessen beginnt und die der Natur auf dem PSI-Gelände wohltuend Raum lässt. Und Natur ist für die Atmosphärenforscherin ein wichtiges Stichwort: Sie liebt es, in ihrer Freizeit auf den Fluren und in den Wäldern mit ihrer Kamera unterwegs zu sein, um Pflanzen, Tiere und Wolken zu fotografieren.
Seit sie 2021 in die Schweiz gekommen ist, ist sie begeistert von Land und Leuten. Sie schätzt vor allem den respektvollen Umgang und sieht in der Schweiz ihre neue Heimat. Wenn man möchte, könnte man auch sagen, sie hat die Schweiz - zumindest nominell - nie verlassen, denn in den 50er- und 60er-Jahren wurde ihr Heimatland, der Libanon, auch als die Schweiz des Nahen Ostens bezeichnet. In Beirut studierte sie zunächst Medizin. Als ihr dann die Arbeit mit dem Skalpell nicht zusagte, orientierte sie sich neu und konzentrierte sich auf Chemie. Mehr und mehr rückte dabei das Thema Luftverschmutzung in den Vordergrund. In ihrer Masterarbeit ging es dann auch um Aerosole, von deren vielfältigen Formen sie bis heute fasziniert ist.
Für ihr weiteres Studium und die Doktorarbeit musste sie den Libanon verlassen. Sie entschied sich, in der Zeitzone des Libanon zu bleiben, um nicht zu weit weg von Familie und Freunden zu sein. Ihr Studium setzte sie dann 2014 in Helsinki fort. Nach ihrer Doktorarbeit 2019 konnte sie weitere internationale Erfahrungen sammeln, als sie eingebunden war in Forschungsprojekte, die in einer Zusammenarbeit von Universitäten in Helsinki und in Beijing entwickelt wurden.
2021 kam sie dann in die Schweiz für die Arbeit als Postdoc am PSI und an der EPFL im Wallis. Hier untersuchte sie, wie sich die europäische Luftverschmutzung zum Nordpol bewegt unter besonderer Berücksichtigung des Klimawandels. Im Labor für Atmosphärenchemie beschäftigt sich Lubna Dada heute mit der Entstehung von Wolken. Sie hat entdeckt, dass ganz bestimmte gasförmige Kohlenwasserstoffverbindungen, sogenannte Sesquiterpene, eine herausragende Rolle bei der Wolkenbildung spielen. Sesquiterpene entstammen vor allem der Vegetation und werden ausgestossen, wenn die Pflanzen gestresst sind. Dieses Wissen hilft, Klimamodelle und Klimavorhersagen zu verbessern.
Anfang 2024 begann sie mit ihrem eigenen, vom Schweizerischen Nationalfonds finanzierten Projekt, das sich auf Bioaerosole aus Pflanzenemissionen und Pollen konzentriert. Das Verständnis der Ursachen und der Emissionsprozesse dieser Partikel ist wichtig für die Beurteilung der Luftqualität an verschiedenen Standorten sowie deren klimatischen Auswirkungen. Ausserdem können dadurch gezielter Minderungsstrategien für eine vom Klimawandel geprägte Zukunft entwickelt werden.
Weitere Artikel zum Thema
Mit Block, Bleistift und Algorithmen
Der PSI-Physiker Dominik Sidler entwickelt grundlegende Theorien für bislang unerklärbare Phänomene.
Löten auf grosser Bühne
Wer hier aufs Podest kommt, gehört zu den weltbesten Berufstalenten: PSI-Elektroniker Melvin Deubelbeiss gewann bei den WorldSkills 2024 die Silbermedaille.
Der Herr des Fliessens
Schon als Student begeisterte sich Athanasios Mokos für die Dynamik von Flüssigkeiten. Heute modelliert er am Paul Scherrer Institut PSI komplexe Vorgänge wie die Bildung von Ablagerungen an Reaktorbrennstäben.