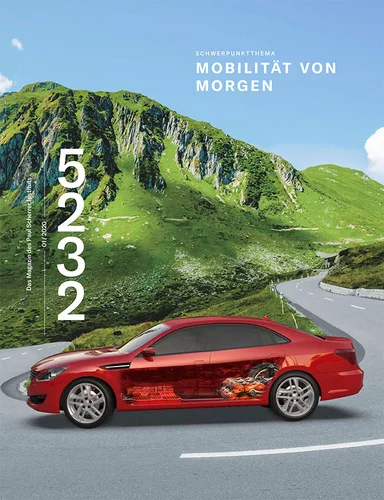Um den Strassenverkehr der Schweiz zukunftsfähig zu machen, ist vor allem Forschung gefragt. In den Grossforschungsanlagen des PSI untersuchen Chemiker und Ingenieure, wie Antriebe effizienter und abgasärmer werden.
«Das Gesamtverkehrssystem der Schweiz 2040 ist in allen Aspekten effizient.» Das strategische Hauptziel des Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) klingt gut. Der Verkehr soll die Umwelt weniger belasten, energieeffizienter und klimaschonender werden, präzisiert das untergeordnete Bundesamt für Energie (BFE). Dazu hat sich die Schweiz ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Bis 2050 will sie klimaneutral sein.
Die Herausforderung ist gross. Laut dem letzten Mikrozensus Mobilität aus dem Jahr 2015 legt im Schnitt jede in der Schweiz wohnende Person rund 24850 Kilometer pro Jahr zurück. Eine hohe Zahl, die auch die Auslandsreisen beinhaltet. Im Alltag und innerhalb der Schweiz sind es pro Person knapp 37 Kilometer pro Tag – Tendenz steigend.
Drei Viertel der Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor, so das Bundesamt für Umwelt (BAFU), werden von Personenwagen, Lastwagen und Bussen verursacht. Daraus ergibt sich: Ob das Land seine Ziele erreicht, hängt ganz wesentlich von den Antrieben dieser Verkehrsträger ab. Deren CO2-Emissionen müssen radikal reduziert werden. Und genau da setzen Forschende unter anderem am PSI an.
Christian Bauer und Brian Cox vom PSI-Labor für Energiesystemanalysen haben in einer Studie ermittelt, wie viel Abgas – insbesondere Treibhausgase – die verschiedenen Antriebsarten von Personenwagen aktuell produzieren – und wie viel sie nach derzeitigen Trends 2040 produzieren werden. Dabei haben sie den gesamten Lebenszyklus der Fahrzeuge bedacht, also von der Produktion bis zur Entsorgung. Vor allem Dieselfahrzeuge sind in den letzten Jahren in die Kritik geraten, da sie besonders viele der gesundheitsschädlichen Stickoxide ausstossen. Die PSI-Forschungsgruppen um Davide Ferri und Maarten Nachtegaal haben herausgefunden, wie sich diese Emissionen erheblich mindern lassen. Schon heute fahren viele Dieselfahrzeuge mit dem Hilfsstoff AdBlue, der ins Abgas eingespritzt wird und dort zu Ammoniak zerfällt. Dieses reagiert unter Mithilfe eines Katalysators mit den Stickoxiden zu harmlosem Stickstoff und Wasser. Jedoch funktioniert das nur dann effektiv, wenn die Abgase eine Temperatur oberhalb von 200 Grad Celsius aufweisen. In den ersten Minuten nach Fahrtbeginn und an kalten Wintertagen bleibt daher viel Stickoxid übrig.
Mit dem konzentrierten Röntgenlicht der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS haben die Forschenden das Katalysatormaterial (eine Kupfer-Zeolith-Verbindung) durchleuchtet und genau beobachtet, was da falsch läuft: Bei niedrigen Temperaturen mindert zu viel Ammoniak die Wirkung des Kupfers. Die Studie der PSI-Forschenden ergab schliesslich, dass je nach Temperatur und Betriebszustand verschiedene Mengen Ammoniak eingespritzt werden sollten, um die Wirkung zu optimieren. So lassen sich die Stickoxid-Emissionen um bis zu 90 Prozent senken.
Dennoch bleibt der Diesel – und, wegen seines höheren Spritverbrauchs, noch mehr der Benziner – ein Antrieb mit negativem Klimaeffekt. Um diesen drastisch zu verringern, braucht es neue Antriebstechnologien möglichst ganz ohne schädliche Abgase.
Nahe liegend sind in dieser Hinsicht Elektroantriebe. Am PSI wird intensiv daran geforscht, deren Technik und vor allem Reichweite zu verbessern, damit sie Diesel und Benziner bald adäquat ersetzen können. Zwei Fragen, auf die PSI-Forschende in diesem Zusammenhang Antworten suchen, beziehen sich auf den Energiespeicher der Elektrofahrzeuge: Welcher Elektrolyt im Akku überträgt die Ladungen am besten? Wie müssen die Elektroden des Akkus beschaffen sein, um eine maximale Energiedichte zu erreichen – ohne dass damit deren Explosionsgefahr steigt? Mit der Lösung dieser beiden Aufgaben liesse sich bereits mit herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus eine deutliche Reichweitensteigerung der Elektroautos erzielen.
Eine Gruppe um die PSI-Chemikerin Sigita Trabesinger zum Beispiel widmet sich in einem Projekt mit dem Chemiekonzern BASF dem Mengenverhältnis der sogenannten Übergangsmetalle, die in der positiven Elektrode, also der Kathode, der Batterie stecken. Trabesinger möchte wissen, wie Änderungen der Zusammensetzung sich auf die Stabilität und Sicherheit der Batterie auswirken. Die gebräuchlichste Verbindung ist das sogenannte NCM, bestehend aus verschiedenen Anteilen Nickel, Kobalt und Mangan. «Das Ziel ist, den Anteil von Nickel zu erhöhen und den von Kobalt so weit wie möglich zu senken», sagt Trabesinger.
Denn Kobalt ist nicht nur toxisch, es ist auch selten und teuer und wird vor allem im Kongo unter sozial und ökologisch fragwürdigen Bedingungen abgebaut. Der technische Vorteil eines höheren Nickelanteils ist ausserdem, dass er die Kapazität der Kathode und damit die Reichweite des Elektroautos steigert. Idealerweise möchten die Forschenden in weiterer Zukunft sogar komplett auf Kobalt verzichten.
Allerdings neigt NCM mit mehr Nickel und weniger Kobalt dazu, an Luft instabil zu sein und sich in der Batterie chemisch reaktionsfreudiger zu verhalten als gewünscht.
Verschiedene Tricks könnten dennoch die neuen Materialien stabilisieren: Probiert wird derzeit die Beigabe extrem geringer Mengen weiterer Elemente oder eine gezielte Oberflächenbeschichtung. Mit den ultrapräzisen Lichtquellen an den Grossforschungsanlagen des PSI untersuchen Trabesinger und ihre Mitarbeitenden, warum genau die Elektroden ohne diese Tricks instabil werden und welche der Änderungen erfolgversprechend sind.
Vielleicht liegt die Zukunft des Elektroantriebs aber auch in der sogenannten Feststoffbatterie. Eine Feststoffbatterie enthält statt des typischen flüssigen Elektrolyts, der die Ladung zwischen den Elektroden transportiert, eine feste Keramik. Deren Vorteile: Sie ist weniger entzündlich als flüssige Elektrolyte. Diese Batterie widersteht auch ohne Kühlung hoher Spannung und hohen Temperaturen – kann also theoretisch schneller laden und spart den Platz für die Kühlvorrichtung. Und auch sie verspricht eine höhere Energiedichte als die derzeitigen Lithium-Ionen-Batterien. Jedoch dauert bei diesen Feststoffbatterien der Ladevorgang noch vergleichsweise lang, weil an sie nur eine relativ geringe Stromstärke angelegt werden kann.
PSI-Forschende sind dem mit der sogenannten Operando Röntgentomografischen Mikroskopie auf den Grund gegangen. «Diese funktioniert prinzipiell wie eine Computertomografie in einem Spital», sagt Strahllinienwissenschaftlerin Federica Marone. «Allerdings ist bei uns an der Grossforschungsanlage SLS der Photonenfluss um einige Grössenordnungen höher. So erreichen wir die erforderliche räumliche und zeitliche Auflösung.» Marone konnte präziser als je zuvor beobachten, wie sich in der Keramik, die in diesem Fall aus Lithium- und Phosphorsulfid besteht, beim Laden Risse bilden: Die Lithium-Ionen zwängen sich in das Molekülgitter von Zinnkügelchen, die in die Keramik eingebettet sind, und vergrössern dadurch deren Volumen um bis zu 300 Prozent. Marone konnte verfolgen, wie sich die Risse ausbreiten und den Fluss der Ionen zwischen den Elektroden stören. Zwar schliessen sich die Risse beim Entladen wieder, da der feste Elektrolyt eine gewisse Elastizität aufweist. Doch die Einschränkung beim Laden bleibt. Mit diesem Verständnis lässt sich nun leichter nach anderen Elektrolytmaterialien suchen, die weniger stark auf die Ausdehnung der Zinnkugeln reagieren. Trotzdem bleibt es bis zu einer fehlerfreien Massenproduktion von Feststoffbatterien noch ein weiter Weg.
Anders sieht es bei den Brennstoffzellen aus. Diese Antriebe haben im Vergleich zur Batterie vor allem einen Reichweitenvorteil, allerdings eine geringere Energieeffizienz. «Die Technologie ist ausgereift, es gibt da eigentlich kein grosses Hindernis mehr», sagt Thomas J. Schmidt, Leiter des Forschungsbereichs Energie und Umwelt des PSI. «Es fehlt nur noch am politischen Willen.»
Derweil wird die Brennstoffzelle weiter optimiert. Auch hier nutzen die Forschenden die einzigartigen Bildgebungsverfahren, die das PSI mit seinen Grossforschungsanlagen ermöglicht. So waren bislang die Vorgänge innerhalb der Brennstoffzelle noch nicht im Detail verstanden. Nun aber lässt sich mithilfe der Neutronenradiografie und der Röntgentomografie per Synchrotronstrahlung während des Betriebs in die Zelle hineinschauen.
In einer Brennstoffzelle läuft eine Reaktion ab, die bereits Schulkinder im Chemieunterricht kennenlernen: Die Gase Wasserstoff und Sauerstoff verbinden sich zu Wasser und setzen dabei Energie frei. Dies spielt sich an den beiden porösen Katalysatorschichten der Elektroden ab, die durch eine Membran getrennt sind. Durch diese Schichten müssen einerseits die beiden Gase diffundieren und andererseits das entstehende Wasser entfernt werden. Vor allem Letzteres ist wichtig, damit eine Brennstoffzelle gut funktioniert. Andernfalls verstopft das Wasser die Poren der Elektroden und behindert so die Gase. Im Winter, wenn das Wasser friert und sich ausdehnt, drohen sogar mechanische Schäden. Die PSI-Forschenden testen deshalb, wie sich der Wasser- und Gasfluss etwa durch Veränderung der porösen Komponenten in der Zelle
optimieren lässt.
Die nächste Generation Brennstoffzellen soll dank besseren Wassermanagements und optimierter Katalysatoren nicht nur haltbarer sein, sondern auch eine höhere Stromdichte bieten. «Die Stromdichte», so Thomas J. Schmidt, «ist vor allem für die Flexibilität des Antriebs wichtig. Und dies wirkt sich direkt auf die Grösse der Brennstoffzellensysteme und damit auf ihre Kosten aus.»
Anwendung finden solche Fortschritte nicht zuletzt in einer Kooperation mit der Firma Swiss Hydrogen (siehe 5232-Ausgabe 1/2018, Seite 18). Sie hat herkömmliche Elektroautos mit Brennstoffzellen aufgerüstet, die den Akku bei der Fahrt aufladen und so die Reichweite erhöhen. Und seit 2017 fährt in der Transportflotte von Coop testweise ein Lastwagen mit einem solchen Antrieb.
Ein grosses Thema hinsichtlich alternativer Antriebe ist auch Erdgas. Schon fossiles Erdgas, mit dem einige Autos heute bereits fahren, ist in Sachen Treibhausgase besser als Benzin oder Diesel. «Methan ist der Hauptbestandteil von Erdgas und hat chemisch ein günstigeres Verhältnis zwischen Wasserstoff und Kohlenstoff und eine höhere Klopffestigkeit als Benzin oder Diesel», erklärt Oliver Kröcher, Leiter des Labors für Bioenergie und Katalyse am PSI. Dadurch kann das Gas im Motor stärker komprimiert werden und effizienter verbrennen. Die CO2-Emissionen sind zwar geringer, dafür muss aber unverbranntes Methan aus dem Abgas entfernt werden. Die dazu nötigen Katalysatoren werden in Kröchers Labor erforscht und entwickelt.
Interessant könnten auch Gasmotoren werden, die mit Biomethan laufen, das aus Biomasse gewonnen wird – auch «Synthetisches Erdgas» (SNG) genannt. Dessen Kohlenstoff wurde zuvor der Atmosphäre entzogen, wodurch zumindest die direkten Emissionen der Fahrzeuge so gut wie klimaneutral sind. Am PSI werden verschiedene Möglichkeiten erforscht, um Biomethan zu erzeugen.
Eine Möglichkeit dafür ist, in Biogasanlagen organische Abfälle zu vergären. Eine entsprechende PSI-Testanlage hat in einem Langzeittest bereits bewiesen, dass sie für den Einsatz im Alltag geeignet ist. Das dabei verwendete Verfahren ist besonders effizient, weil nicht nur Methan aus der Vergärung gewonnen wird, sondern auch noch Kohlendioxid in den Gärgasen mithilfe von zugesetztem Wasserstoff ebenfalls zu Methan umgewandelt wird (siehe 5232-Ausgabe 1/2018, Seite 16).
Ökologisch ergibt das gesamte Verfahren aber nur dann Sinn, wenn auch der zugesetzte Wasserstoff mit erneuerbarer Energie produziert wird – das gilt hier genauso wie bei Brennstoffzellen. Zum Beispiel per Elektrolyse. Auch daran forscht das PSI: «Wir entwickeln geeignete Materialien, die für eine effiziente Elektrolyse sorgen», sagt Felix Büchi, Leiter des Labors für Elektrochemie.
In einigen dieser Bereiche teilen die PSI-Forschenden ihr Expertenwissen mit anderen Schweizer Instituten, darunter auch die Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Empa. «Die Empa ist uns in vielen unserer Forschungsprojekte eine kompetente Partnerin», so PSI-Forschungsbereichsleiter Schmidt. Gemeinsam mit weiteren Schweizer Instituten und Hochschulen arbeiten das PSI und die Empa im Rahmen der Kompetenzzentren «Heat and Electricity Storage» sowie «Mobility» zusammen. Letzteres hat, wie der Name andeutet, das Thema «effiziente Mobilität».
«Effizienz» ist in der Tat das Zauberwort bei der Fortentwicklung vieler alternativer Antriebe. Wobei die Experten betonen, dass man stets das Gesamtverkehrssystem und die Wirtschaftlichkeit im Auge behalten müsse: «Schliesslich geht es darum, möglichst umweltschonend und bezahlbar von A nach B zu kommen», sagt Serge Biollaz, Forschungsgruppenleiter für thermochemische Prozesse am PSI. «Dafür müssen wir viele Lösungen sinnvoll verketten. Und wir brauchen nicht nur eine Antriebstechnologie für die Mobilität der Zukunft, sondern eine ganze Fülle. Nur dann können wir die Schweizer Ziele für ein effizientes und CO2-armes Verkehrssystem erreichen.»